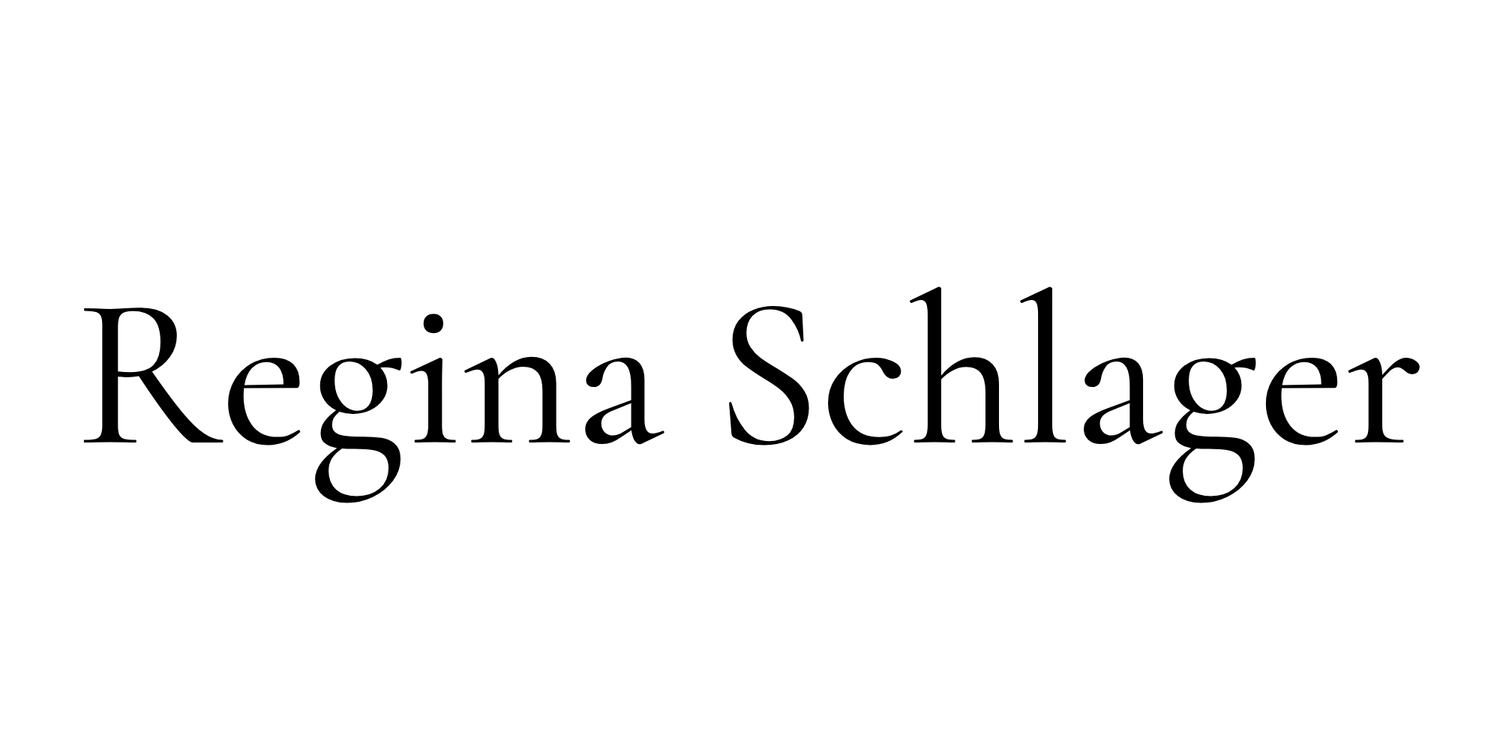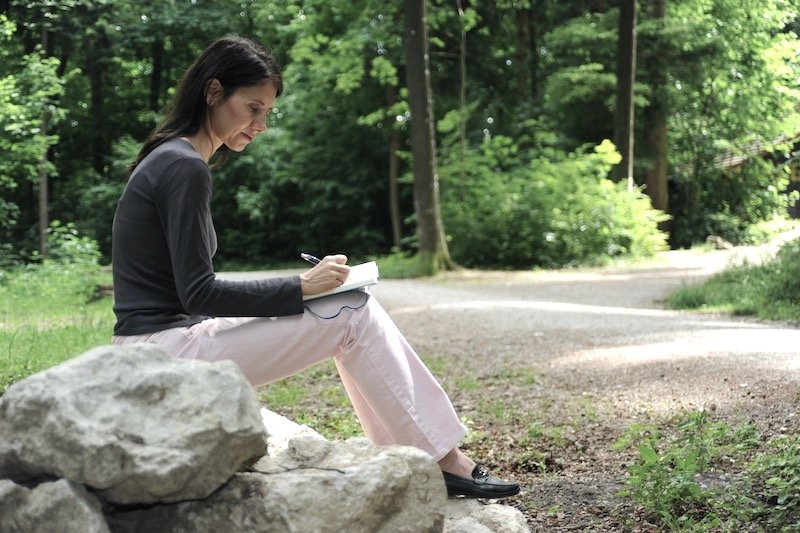Blog – Berufung gestalten
Du findest hier Impulse, Tipps und Erfahrungsberichte rund um die Themen berufliche und persönliche Entwicklung mit Achtsamkeit und Selbstfürsorge.
Warum Self-Care ein erweitertes Selbst braucht
Selbstfürsorge trifft häufig auf den Vorwurf, egoistisch zu sein. Das hängt damit zusammen, wie die Sorge für sich selbst von der Werbung ausgenutzt wird, aber auch mit einem engen Verständnis vom Selbst. “Indigenialität” (Andreas Weber)kennt kein abgetrenntes Selbst.
Mit dem Jahreslauf mitgehen
Mit den Qualitäten der Jahreszeiten mitzugehen, statt gegen sie anzukämpfen, gibt Energie und schafft ein Gefühl der Verbundenheit. So wirkt jetzt gerade die spätwinterliche Phase der Vision, laut 5-Elemente-Lehre beginnt heute, 15. Februar, sogar bereits die Frühlingsqualität Holz.
Wie kreatives Schreiben dich bei deiner Entwicklung unterstützt
Mit Hilfe von kreativem Schreiben lernst du dich selbst besser kennen und drückst deine Kreativität aus. Schreiben und Coaching lassen sich toll verbinden. Ich stelle dir in diesem Artikel Schreibmethoden und konkrete Übungen vor. Damit du gleich loslegen kannst!
Mein Jahresrückblick 2023
Neue Website, Rebranding, 1:1-Coachings, Abschluss Schreibpädagogik, Beginn mit Workshops kreatives Schreiben, Schreibcafé Schütze, wertvolle Begegnungen, mein eigenes kreatives Schaffen, Selbstfürsorge – 2023 war reich und wertvoll!
Neujahrsvorsätze: Was meistens übersehen wird und wie sie gelingen
Neujahrsvorsätze scheitern häufig, weil die Basis dafür fehlt, um die Jahresziele umzusetzen. Du erfährst in diesem Artikel, was diese Basis ausmacht und erhältst konkrete Methoden, wie du deine Neujahrsziele erreichst.
Innehalten: 7 Tipps um zu Weihnachten zur Ruhe zu kommen
Gerade zur Weihnachtszeit ist es schwierig, eine Pause einzulegen, innezuhalten und zu dir selbst zu kommen – es ist einfach so viel los. Besinnliche Zeit? Wohl eher stressig. Ich gebe dir in diesem Blogartikel sieben Tipps, wie es dir dennoch gelingt, rund um Weihnachten und den Jahreswechsel zur Ruhe zu kommen.
Zufriedenheit – die stille Schwester des Glücks
Zufriedenheit trägt wesentlich dazu bei, deine Berufung zu leben. Dabei sind Glück und Zufriedenheit verwandt, aber nicht gleich: Zufriedenheit ist wie die unauffällig gekleidete, ruhige und weise Verwandte des strahlenden, extrovertierten Glücks, die sich bescheiden im Hintergrund hält und doch wesentlich zum Wohlbefinden beiträgt.
Emotionen sind wie Gefühle, die eingefroren sind - sie lassen sich auftauen
Emotionen und Gefühle sind unterschiedlich. Gefühle sind wichtige Wegweiser. Emotionen sind wie Eiswürfel in unserem Inneren: etwas durfte oder konnte nicht gefühlt werden. Wenn du lernst, sie aufzutauen, wird Lebensenergie frei: kreative Anteile in dir. Dafür braucht es Achtsamkeit und Selbstmitgefühl.
Gefühle zulassen bringt dich in deine Lebendigkeit
Wenn du deine Gefühle zulässt, ist das wie ein Fluss, der fließen darf. Du bist im Flow. Gefühle zulassen, das gelingt, wenn du all Gefühle, die in dir auftauchen, achtsam wahrnimmst. Dann kannst du auch Anteile in dir befreien, die feststecken. Emotionen, die in dir festgefroren sind. Du bist nicht mehr mit angezogener Handbremse unterwegs. Du gelangst in deine volle Lebendigkeit. Deine Power.
Focusing: Eine kraftvolle Methode gegen Stress und für deine berufliche und persönliche Entwicklung
Focusing ist eine achtsame Methode, die von Eugene Gendlin entwickelt wurde. Sie hilft bei der Stressbewältigung, für mehr Gelassenheit im Job, aber auch für mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. In diesem Artikel beschreibe ich, was Focusing ist, wie ich selbst dazu gekommen bin und welche Ressourcen es gibt, um sich über Focusing zu informieren und die Focusing-Methode zu lernen.
Glaubenssätze: Was sie sind und wie du einen negativen Glaubenssatz änderst
Was bedeuten Glaubenssätze? Oft wird von Glaubenssätzen gesprochen, als wären sie alle negativ. Doch ein Glaubenssatz ist nicht an sich etwas, das falsch ist. Der Schlüssel im Umgang mit Glaubenssätzen liegt in der Bewusstheit: Wie erkennst du sie? Welche sind positive Glaubenssätze für dich? Welche Glaubenssätze möchtest du auflösen – und wie tust du das?
Mut: Courage oder Schneid – was bringt dich eher weiter?
Veränderung braucht Mut! Wünscht du dir mehr Mut, weißt aber nicht, wie du Mut fassen kannst? Mut lernen, das geht: ich gebe dir in diesem Artikel Tipps dazu. Das fängt damit an zu erkunden, was Mut ist. Denn mutig sein, das brauchst du, um deinen Weg mit Selbstvertrauen und Zuversicht zu gehen. Gleich vorweg: Für mich hat Mut eher etwas mit Courage, also mit dem Herzen, zu tun als mit draufgängerisch sein.
Grenzen setzen: Wie du gesunde Grenzen entwickelst
Grenzen setzen und Nein sagen ist nicht einfach. Doch es ist wichtig, um zu dir selbst zu stehen und deine Berufung zu leben. Ich schreibe in diesem Artikel darüber, was Grenzen sind und zeige dir praktische Übungen zum Grenzen setzen. Damit du gesunde Grenzen entwickeln kannst, die dich zu dir selbst führen und auch in guten Beziehungen mit anderen sein lassen.
Eine Vision entwickeln: Schritte zur persönlichen Entfaltung und beruflichen Neuorientierung
Bist du unzufrieden mit deinem Beruf und fühlst dich gestresst und innerlich unruhig? Möchtest du eine Veränderung in deinem Leben herbeiführen und dich persönlich weiterentwickeln? Dann ist es Zeit, deine Vision zu entwickeln. Eine klare Vision hilft dir dabei, deine Ziele zu setzen und zu erreichen, dein Leben nach deinen Wünschen zu gestalten und deine persönliche und berufliche Entwicklung zu fördern.
Resilienz aufbauen: Geschmeidig mit Belastungen umgehen und daran wachsen
Stress im Job, Geldsorgen, dich neu orientieren, eine neue Lebensphase, eine schwere Krankheit, der Tod einer geliebten Person – all das sind schwierige Situationen, die uns leicht den Boden unter den Füßen wegziehen. Resilienz ist ein wichtiger Aspekt für die Stressbewältigung, aber nicht nur. Sie hilft dir auch, deine Berufung zu leben. Doch was genau ist Resilienz und wie kannst du deine Resilienz stärken?
Was ist Arbeit? Ein Gespräch mit Wilhelm Schmid - #026 (Podcast)
Was ist Arbeit? Darüber habe ich ein Interview mit dem Philosophen Wilhelm Schmid geführt. In dieser Podcast-Folge erfährst du, warum Arbeit mehr als Erwerbsarbeit ist und warum ein erweiterter Begriff von Arbeit, der auch die Sorgearbeit (Care-Arbeit) einschließt und die Arbeit an sich selbst, zu mehr Zufriedenheit im Leben führt.
Wie du deine Berufung achtsam gestaltest
Deine Berufung ist mehr als dein Beruf. Und doch ist die berufliche Neuorientierung häufig der erste Schritt zu einem erfüllten Leben: wenn du dabei auch lernst, achtsam mit dir selbst umzugehen und dich gut um dich selbst zu kümmern. In diesem Artikel zeige ich dir, welche Aspekte dabei wichtig sind und wie Kreatives Schreiben als kraftvolle Methode ins Spiel kommt.
Selbstfürsorge: 3 wirkungsvolle Übungen, wie dir kreatives Schreiben dabei hilft
Selbstfürsorge trägt entscheidend dazu bei, dich nicht gestresst zu fühlen, auf deine Bedürfnisse zu achten und Dankbarkeit zu kultivieren – und all das sind wesentliche Elemente, um deine Berufung zu leben. Schreiben kann dabei als Methode hervorragend helfen. Im folgenden Artikel zeige ich dir, wie du mit drei Übungen aus dem Kreativen Schreiben mit dir selbst in Kontakt kommst und dich gut um dich kümmerst.
Mut zur Unvollkommenheit
Viele Frauen, mit denen ich arbeite, schleppen mit sich herum, nicht gut genug zu sein. Nicht gut genug im Job. Nicht gut genug bei dem, was ihnen eigentlich Freude macht: malen, schreiben, singen und handwerken. Das führt dazu, dass einige es ganz sein lassen möchten. Es bremst uns aus. Haben wir den Mut zur Unvollkommenheit, denn das bringt uns in unsere Kreativität. Ich liste in dem Artikel Möglichkeiten auf, wie du den Mut zur Unvollkommenheit praktizieren kannst.
Den Wandel wagen. Ein Gespräch mit Christine und Matthias Jung - #025 (Podcast)
In dieser Podcast-Episode spreche ich mit Christine Jung und Matthias Jung über ihr gemeinsames Buch "Den Wandel wagen. Widerstände überwinden auf dem Weg in eine bessere Zukunft". Sie behandeln Wandel aus persönlicher und gesellschaftlicher Sicht.
Starte deine Reise
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.