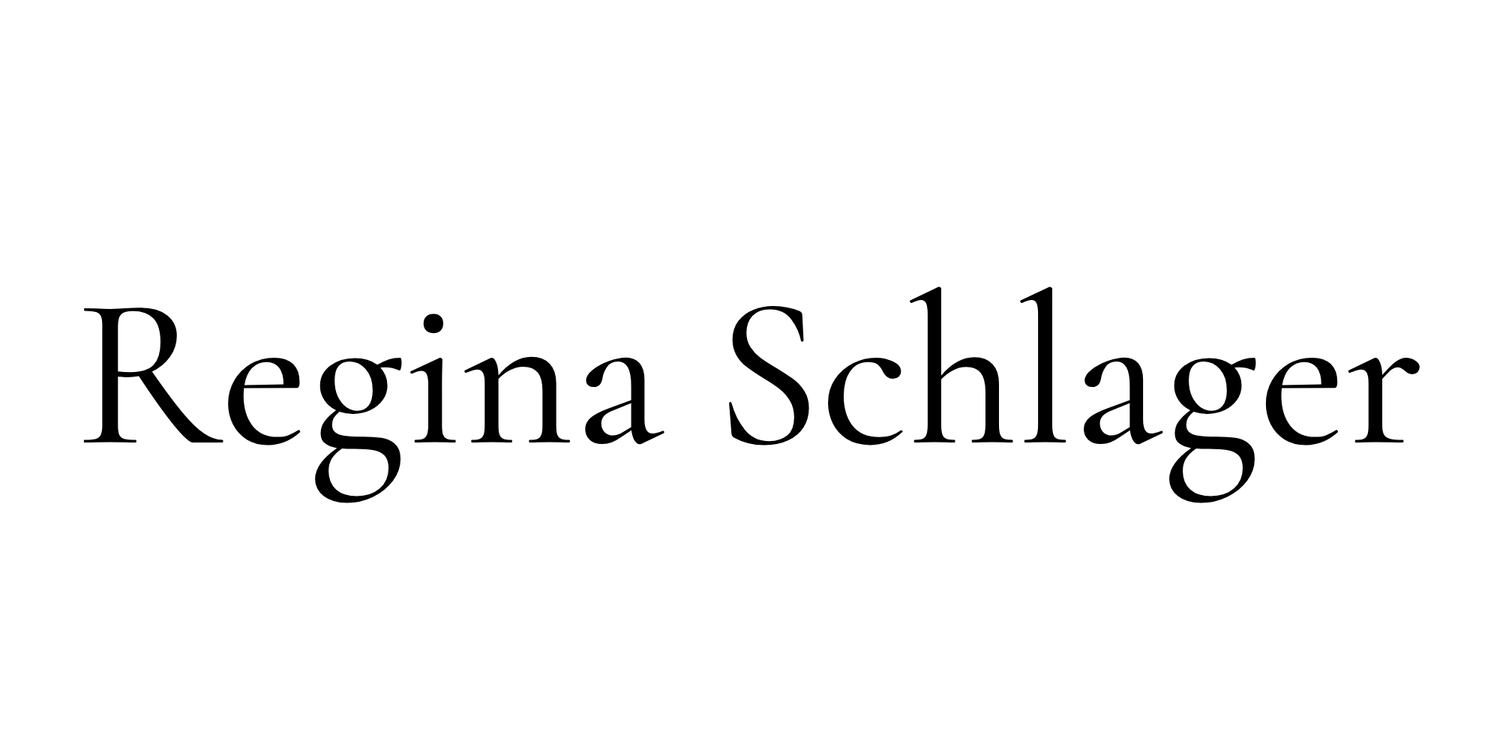Bernard Pörksen: Zuhören (Rezension)
Wie gelingt Zuhören? Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler, geht dieser Frage in seinem im Januar 2025 erschienenen Buch "Zuhören. Die Kunst, sich der Welt zu öffnen" nach. Seine Antworten sind vielschichtig.
Wie funktioniert geistige Offenheit trotz eigener Vorannahmen?
Bernhard Pörksen fragt sich, wie geistige Offenheit funktioniert. Häufig verhindern Blockaden des Zuhörens, sich dem zu öffnen, was von den eigenen Auffassungen abweicht. Denn wir laufen mit Vorannahmen durch die Welt – sie prägen, was wir hören.
Wie können wir uns von vorschnellen Urteilen lösen und zuhören? In persönlichen Beziehungen und auch bei gesellschaftlich relevanten Themen wie Missbrauch und Klimakrise?
Der Autor Bernhard Pörksen
Dr. Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Eine Auswahl weiterer Bücher von ihm: Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, mit dem Kybernetiker Heinz von Foerster (1998), Kommunikation als Lebenskunst, mit dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun (2014), Die große Gereiztheit (2018)
Zuhören mit dem Ich-Ohr und dem Du-Ohr
Eine wesentliche Unterscheidung, die der Autor einführt, ist die in Ich-Ohr-Zuhören und Du-Ohr-Zuhören.
Beim Ich-Ohr-Zuhören stecken wir in unseren persönlichen Urteilen und Vorurteilen. Wir hören mit einem Filter, wir hören vor allem uns selbst. Wir wollen unsere Auffassungen bestätigt finden.
Bei Du-Ohr-Zuhören gehen wir davon aus: "In welcher Welt ist das, was der andere sagt, plausibel, sinnvoll, wahr?" (S. 28) Wir bemühen uns, die eigene Perspektive, zumindest ein Stück weit, zu weiten.
Aufbau des Buches
Das Buch gliedert sich in 3 Teile:
Philosophie des Zuhörens
Praxis des Zuhörens
Politik des Zuhörens
1. Philosophie des Zuhörens
Im ersten Teil legt Bernhard Pörksen das Erlebnis offen, das zu diesem Buch geführt hat. Er bringt sich also persönlich ins Spiel. Etwas, das bei Wissenschaftlern (im deutschsprachigen Raum?) offensichtlich immer noch erklärungsbedürftig ist.
Es ist seine eigene Tiefengeschichte, wie Pörksen das nennt, die ihn zunächst hat hinhören lassen. Er hatte aufgrund der Erfahrung mit einem sadistischen Lehrer einen Hintergrund für die Wahrnehmung von Unstimmigkeit bei der Beschreibung des Pädagogen Gerold Becker in der Autobiografie des Reformpädagogen Hartmut von Hentig. Die Geschichte des vielfachen Missbrauchs an der Odenwaldschule in Deutschland und der Umgang damit ist das erste Fallbeispiel im zweiten Teil des Buches.
2. Praxis des Zuhörens
Im zweiten Teil bringt der Autor Fallstudien, die er als Streifzüge bezeichnet.
Die Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule, einer reformpädagogischen Einrichtung in Deutschland, die jahrzehntelang vertuscht wurden. Was brauchte es für den Kipppunkt der Wahrnehmung 2010, wo sie plötzlich eine große mediale Aufmerksamkeit erlangten?
Die Beharrlichkeit und den Mut von Missbrauchsopfern, eine neue Schuldirektorin mit eigener Missbrauchserfahrung, die den Schülerinnen und Schülern wirklich zuhörte, eine geänderte Medienlandschaft und Missbrauchsfälle an einer katholischen Institution, die öffentlich wurden und wo es auch einen engagierten Leiter gab.
Der Ukrainekrieg, wo Präsident Selenski es zunächst schaffte, die westliche Wertegemeinschaft zum Zuhören zu bringen und der Unternehmer Misha Katsurin ein Gesprächs- und Dialogprojekt entwickelte: Die Menschen in der Ukraine mit Verwandten in Russland sollten diesen als vertraute Personen von den Kriegsereignissen in der Ukraine berichten. Was hoffnungsvoll begann, zeigte am Beispiel Katsurins selbst Zuhörblockaden auf: Sein Vater glaubte ihm seine Schilderungen der Bombeneinschläge und Kämpfe nicht.
Das Beispiel Silicon Valley zeigt eindrücklich, wie sehr sich der ursprüngliche Digital-Utopismus gewandelt hat. Die moderne Medientechnologie wurde zunächst als ideales Instrument gesehen, um alle mit allen zu vernetzen und eine barrierefreie Kommunikation ohne Hierarchien zu schaffen.
Bernhard Pörksen führte Gespräche mit der Künstlerin Jenny Odell, die nach der Wahl 2016 begann, sich auf eine Parkbank zu setzen, zu der sie fast täglich wiederkehrte: Einfach um die Vögel zu beobachten, zu lauschen, zu schreiben. Sie praktiziert Deep Listening, tiefes Zuhören. Sie möchte ein Leben führen das "Selbstfürsorge und engagierte Zeitgenossenschaft verbindet" (S. 174).
Die Klimakrise mit den Phänomenen Verleugnung auf der einen Seite und eine Form der Sensibilität, die Pörksen ökologisches Gehör nennt. Wie kommt es zum einen, wie zum anderen?
3. Politik des Zuhörens
Im dritten Teil beschäftigt sich Bernhard Pörksen mit der Frage, warum sich trotz sozialer Medien so viele Menschen nicht gehört fühlen, und er entlarvt Zuhör-Appelle in der Politik als Leerformeln politischer Rhetorik. Denn Zuhören sei dialogisch und brauche einen geschützten Raum und speziellen Rahmen.
Aber – muss ich allen zuhören?
Für mich als Leserin taucht die Frage auf, ob ich allen zuhören muss. Wo zieht man die Grenze, wem man zuhört? Wie umgehen mit der Person, die sich rassistisch äußert und keinerlei Bereitschaft zeigt, auch andere Meinungen anzuhören? Oder mit jemandem, der behauptet, Frauen seien weniger wert als Männer, ihre Unterdrückung sei gerechtfertigt?
"Man kann Menschen zum Schweigen bringen, das ist möglich. Aber man kann sie nicht zum Zuhören zwingen." (S. 40)
Zuhören ist nur in Freiheit denkbar, so Pörksen. Und liegt damit in unserer Verantwortung. Wir entscheiden, je nach Situation, wem wir unser Gehör schenken oder wie wir auf Gesagtes reagieren, das unseren Auffassungen grundlegend widerspricht.
Doch sei es wichtig, das nicht vorschnell zu tun, auf Grundlage der eigenen Vorurteile, sondern sich mit dem jeweiligen Menschen und der Situation auseinanderzusetzen. Dann sei die Entscheidung, nicht zuzuhören – sich beispielsweise nicht mit jemandem zu einer Veranstaltung auf ein Podium zu setzen - wohlbegründet.
Es gibt keine letztgültige, allgemeine Antwort, wem man zuhören soll und wem nicht. Und auch kein allgemein zu definierendes “richtig zuhören”. Hier wird für mich deutlich, wie sehr Zuhören tatsächlich eine Kunst ist. Und ich würde hinzufügen: Eine Praxis, etwas, das geübt werden muss. Scheitern inbegriffen.
Fazit
Das Buch ist kein Ratgeber und bietet keine Schritte-Anleitung für besseres Zuhören, das macht Bernhard Pörksen gleich zu Beginn klar. Wer also Übungen zum Zuhören sucht, wird mit diesem Buch nicht zufrieden sein.
Aber keine Angst, es handelt sich nicht um eine abstrakte wissenschaftliche Abhandlung, sondern bietet vielmehr vielschichtige Gedankengänge und Beschreibungen zu dem komplexen Phänomen des Zuhörens und Gehörtwerdens. Diese bleiben nicht beim Einzelnen im privaten Bereich stehen, sondern beziehen sich ebenso auf gesellschaftliche Vertuschungen, Kriegssituationen, die digitalen Technologien und die Klimakrise.
Ich mag den philosophisch-medienwissenschaftlichen Zugang mit persönlicher Note und die Beispiele im Teil Praxis des Zuhörens. Es wird deutlich, wie lange und eingehend sich der Autor mit dem Thema beschäftigt und wie intensiv er das Gespräch gesucht hat – wie gut er zugehört hat.
Ein Buch mit Tiefgang und mit viel Futter für eigene weitere Erkundungen!
Angaben zum Buch
Titel: Zuhören. Die Kunst, sich der Welt zu öffnen
Autor: Bernhard Pörksen
Verlag: Hanser, München
Erscheinungsjahr: 1. Aufl. 2025
ISBN: 978-3-446-28138-7
Weiterführende Links:
SRF – Sternstunden der Philosophie: Bernhard Pörksen – Zuhören als Kunst, sich der Welt zu öffnen (09.02.2025)